Eine Standortbestimmung
von Walter H. Greiner, 1993
Vorwort
Einem gängigen Klischee zufolge sind Transsexuelle Menschen, die ihr Geschlecht wechseln.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Zwar gibt es eine erhebliche Anzahl von Betroffenen, für die tatsächlich der komplette Wechsel der Geschlechtsrolle einschließlich der chirurgischen Umgestaltung des Körpers der einzig mögliche Weg ist. Diese Menschen bilden jedoch nur die Spitze des Eisbergs.
Sozusagen unter der Wasserlinie verborgen lebt eine größere Anzahl Betroffener, die zwar wohl unter einer transsexuellen Veranlagung leiden, für die aber der komplette Geschlechtswechsel eine zu radikale Lösung wäre. Die geschlechtliche Irritation geht bei ihnen weniger weit als bei »echten« Transsexuellen: nicht weit genug, um die Einschränkungen und Risiken des Geschlechtsrollenwechsels zu rechtfertigen, aber doch zu weit, um im körperlichen Geschlecht zufrieden leben zu können.
Die Folge ist meist Verheimlichung und Verdrängung: ein »falsches« Leben gegen die geschlechtliche Natur, geplagt von vielerlei psychosozialen Störungen. Ein Ausbruch aus dieser Situation wird den Betroffenen durch das festgefügte Geschlechterbild unserer Gesellschaft sehr erschwert, ist aber doch möglich: das vorliegende Heft soll einen Lösungsweg aufzeigen.
Der Text gibt einen Vortrag wieder, den ich anlässlich der Fachtagung 1993 der TRANSIDENTITAS e.V. in Frankfurt gehalten habe. Für die schriftliche Veröffentlichung habe ich ihn leicht überarbeitet und mit ein paar zusätzlichen Anmerkungen versehen.
Walter H. Greiner
Meine Damen und Herren, liebe Mitbetroffene,
Ich trete hier ans Rednerpult in einer äußeren Erscheinung (1), die auch unter Transsexuellen bislang nicht üblich ist. Ich tue das sehr bewusst und in provozierender Absicht; und ich möchte Sie bitten, sich Ihrerseits bewusst zu machen, welche Gedanken und Empfindungen das in Ihnen hervorruft: Sympathie? Mitleid? Peinlichkeit? Belustigung? Oder gar Ärger und Empörung? Solche spontanen Gefühlsregungen werden in meinem Vortrag eine wichtige Rolle spielen.
Zunächst ein paar Worte zu meiner Person: Ich bin Mann-zu-Frau-transsexuell. Bis zu meinem 37. Lebensjahr – ich bin jetzt 44 – habe ich verzweifelt versucht, als »normaler« Mann zu leben: habe studiert und mein Geld verdient, bin eine Ehe eingegangen mit einer Frau, die nicht zu mir passte (nur, um überhaupt eine Partnerin zu haben…), habe schließlich mit dieser Frau eine Tochter gezeugt – um dann nach einigen Jahren das Handtuch zu werfen, weil der Leidensdruck unerträglich wurde. Eine Psychotherapie half mir, endlich zu erkennen, was eigentlich mit mir los war, und zu einem entsprechenden Lebensstil zu finden: ich bin kein Mann im üblichen Sinn. Ich habe sehr viel Weibliches in mir.
Wenn auch viele Besonderheiten Transsexueller stereotyp bei fast allen Betroffenen zu beobachten sind, so gleicht doch kein transsexuelles Schicksal einem anderen. Jeder von uns muss seinen individuellen Weg finden. Mein Weg führte mich nach dem Prozess des Bewusstwerdens zu einem Balanceakt: beruflich und in der Öffentlichkeit bleibe ich in der männlichen Rolle. Je privater der Rahmen wird, desto offener und konsequenter lebe ich meine weibliche Seite bis hin zu einer Beziehung mit meiner Freundin, die man ihrer Art nach durchaus als lesbisch bezeichnen könnte. Die operative Geschlechtsangleichung habe ich nicht machen lassen und habe es auch nicht vor. Allerdings habe ich meinen Körper durch Östrogengaben ein Stück weit verändert – eine Maßnahme, die sich auch in mittlerweile mehrjähriger Rückschau für mich als richtig und notwendig erwiesen hat.
So viel zu meiner Person. Um nun endlich zum Thema zu gelangen, muss ich erst ein paar grundlegende Dinge darstellen. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte; um diesen Teil meines Vortrags möglichst kurz zu gestalten, will ich einige schematische Darstellungen zu Hilfe nehmen.
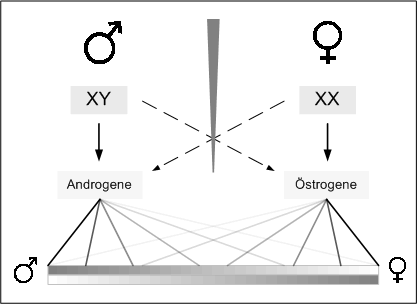
Die landläufige Meinung zur Geschlechtlichkeit der Menschen ist, dass es zwei Sorten von Menschen gibt: Männer und Frauen. Jeder Mensch ist demnach entweder männlich oder weiblich. Gleichzeitig männlich und weiblich zu sein, gilt als unmöglich. Wenn mancher von Ihnen die Tatsache, dass ich hier als Mann mit unverkennbar weiblichen Brüsten vor ihnen stehe, »einfach unmöglich« findet, so ist das Ausdruck eben dieser Überzeugung. Zwar ist das, was ich hier unter meinem Pullover erkennen lasse – und auch die Art, wie ich es tue, für die Hälfte der Menschheit das Selbstverständlichste auf der Welt und insofern ganz und gar normal und menschlich: stellt aber ein Vertreter der anderen Hälfte gleiches in gleicher Weise zur Schau, so wird das üblicherweise nicht als normal menschlich empfunden, sondern eher als Monstrosität – ungeachtet moderner psychologischer Auffassungen, die beiden Geschlechtern jeweils auch gegengeschlechtliche Anteile zusprechen.
Dabei gilt dieses kompromisslose Entweder-Oder eigentlich nur für den Moment unserer Zeugung: für die frisch befruchtete Eizelle nämlich, und selbst da nur für ein einziges von 46 Chromosomen, das in der Tat entweder die weibliche X- oder die männliche Y-Form hat. Bereits die Entwicklung der männlichen und weiblichen Geschlechtszellen erfolgt nicht mehr unmittelbar gesteuert durch diesen chromosomalen Unterschied, sondern indirekt vermittelt durch Hormone. Und so gut wie alles, was wir an uns als »männlich« oder »weiblich« erkennen, wird schließlich nicht direkt durch unser Erbmaterial, sondern durch Geschlechtshormone während der Entwicklung im Mutterleib und später in der Pubertät geformt: durch männliche Androgene und durch weibliche Östrogene.
Das ist nun kein Alles-oder-Nichts-Effekt mehr, sondern ein quantitativer Effekt: jeder Mann hat auch einen gewissen Anteil weiblicher, jede Frau einen gewissen Anteil männlicher Hormone in sich. Die biologische Unterscheidung zwischen Mann und Frau ist keine absolute – es gibt eine Skala zwischen »männlich« und »weiblich«, auf der jeder von uns seinen individuellen Platz hat – eine Skala mit beliebigen Zwischenstufen. Die angeblich unüberbrückbare Kluft zwischen ausgewachsenen Männern und Frauen existiert in Wirklichkeit nicht: es gibt einen gar nicht so kleinen Anteil Menschen – Intersexuelle; etwa jeder tausendste Mensch ist davon betroffen – die schon von Geburt an auch körperlich Merkmale beider Geschlechter tragen: auf unserer Skala wären diese Menschen also etwa in der Mitte einzuordnen.
Woher kommt nun das so weitverbreitete Vorurteil eines absoluten Gegensatzes zwischen Mann und Frau? Stellen wir uns die Gesamtheit der Menschen als Sandkörner vor und plazieren wir sie entsprechend ihren Eigenschaften auf der Skala zwischen männlich und weiblich,
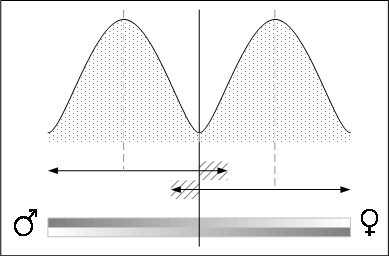
dann ergibt sich eine Verteilungskurve mit zwei Maxima und einem Minimum dazwischen – zwei Haufen sozusagen, die die Masse der Männer und der Frauen repräsentieren. Die allermeisten Männer haben viel Männliches und nur relativ wenig Weibliches – ebenso verfügt die große Mehrzahl der Frauen über sehr deutlich weibliche Attribute und vergleichsweise wenig männliche. Diese Masse an Menschen prägt die öffentliche Meinung über die Teilung der Geschlechter – zumal sie im Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht die Unterschiede – teils aus sexuellen, teils aus kulturellen Gründen – noch zusätzlich pflegen und herausstellen.
Aber es gibt eben auch eine Minderheit von Menschen, die ihren Platz zwischen den beiden Haufen findet: Menschen also, bei denen sich oft gar nicht so recht sagen lässt, ob sie nun Männer oder Frauen sind. Und es gibt eine noch weitaus kleinere Minderheit von Menschen, die dem so weitverbreiteten polarisierten Bild von »Mann« und »Frau« tatsächlich entsprechen: die also besonders wenig gegengeschlechtliche Anteile in sich haben. In unserem Schema wären das die Punkte ganz außen an den Rändern der Skala. Und obwohl solche Menschen – ebenso die zwittrigen Menschen in der Mitte der Skala – schon fast exotische Minderheiten darstellen, sind sie keineswegs von vornherein als krank oder behindert zu bezeichnen: sie markieren mit ihrem Anderssein nur die Extrempunkte dessen, was beim Menschen zur Bandbreite geschlechtlicher Normalität gehört.
Die hier gezeigte Kurve ist eine statistische Darstellung – und Statistik beruht auf Vereinfachung. Greifen wir also zur genaueren Betrachtung einen einzelnen Menschen aus dem Haufen, einen ganz durchschnittlichen Mann oder eine ganz »normale« Frau – dann stellen wir fest, dass dieser Mensch keineswegs so starr auf einen bestimmten Punkt auf der Geschlechtsskala festgelegt ist, wie man nach der oberen Darstellung meinen könnte. Ganz im Gegenteil: sein »Punkt« auf der Skala stellt nur einen Mittelwert dar, einen Standpunkt, den dieser Mensch relativ häufig einnimmt; aber seine individuellen Möglichkeiten reichen bei jedem ganz normalen Mann vom absoluten Macho-Verhalten bis in Bereiche, die bereits eindeutig als weiblich gelten und deshalb für einen Mann üblicherweise mit gesellschaftlichen Tabus belegt sind. Umgekehrt hat auch jede durchschnittliche Frau einen individuellen Handlungsspielraum vom Superweibchen bis hin zu deutlich männlichen Verhaltensweisen. Freilich steht hier keinem Menschen die ganze Skala an Möglichkeiten zur Verfügung: ein Mann kann von Natur aus ein Ausmaß an Männlichkeit demonstrieren, das eine Frau auch bei größter Bemühung und völliger Missachtung gesellschaftlicher Konventionen niemals erreichen kann und umgekehrt.
Aber auch die eben gezeigte Darstellung ist noch eine grobe Vereinfachung. Unsere Geschlechtlichkeit ist nämlich keineswegs eine kompakte, in sich geschlossene Eigenschaft, die sich isoliert von sonstigen Belangen unseres Lebens beschreiben ließe. Die vor allem von feministischer Seite lange Zeit vertretene These, der Unterschied zwischen Mann und Frau beschränke sich im Grunde auf den »kleinen« Unterschied der körperlichen Merkmale, hat sich im Lauf der vergangenen Jahrzehnte als krasser Irrtum erwiesen. Wir wissen heute, dass, so gut wie alle Aspekte unseres Seins ihre geschlechtlichen Besonderheiten haben: Unser Denken. Handeln, Fühlen, unsere Gestik und Mimik, unsere Sprache, unsere Bewegungsabläufe, unsere sinnliche Wahrnehmung, die Art, wie wir uns kleiden, unser ganzes soziales Verhalten: all das trägt Merkmale von Männlichkeit oder Weiblichkeit, ob wir nun wollen oder nicht. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn dem nicht so wäre: denn die Trennung in zwei Geschlechter hat viel tiefere Wurzeln in der Evolution als der Mensch selbst, es gab sie schon, als es noch keine Säugetiere, ja vermutlich noch nicht einmal Wirbeltiere gab. Buchstäblich alles, was uns zu Menschen macht, hat sich bereits unter der festen Voraussetzung der Geschlechtertrennung entwickelt und wurde davon beeinflusst.
Ich habe in dem vorliegenden Schema
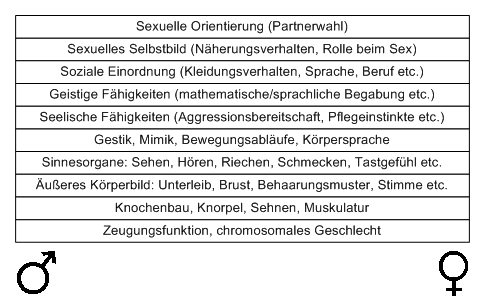
versucht, die verschiedenen Aspekte unserer Geschlechtlichkeit wenigstens grob zu unterteilen. Gehen wir von unten nach oben vor. Da sind zunächst einmal die körperlichen Merkmale: das chromosomale Geschlecht und die Zeugungsfunktion sind die einzigen Aspekte, in denen wir tatsächlich nur Mann oder nur Frau sein können – abgesehen von sehr seltenen Chromosomenaberrationen. Die Chromosomen in unseren Zellen können wir überhaupt nicht verändern, die Zeugungsfunktion können wir allenfalls zerstören, aber niemals umkehren.
Etwas anders sieht das schon bei unserem Knochen- und Bewegungsapparat aus: da lassen sich durch sportliches Training oder auch durch Chirurgie bereits geringfügige Korrekturen erreichen. Durch frühzeitige Hormongaben vor Abschluss des Wachstums wäre sogar eine sehr erhebliche Angleichung an das andere Geschlecht möglich.
Dasselbe gilt verstärkt für unser äußeres Erscheinungsbild: Brust, Unterleib, Haut- und Behaarungstyp, die Stimme: all das lässt sich auch beim erwachsenen Menschen schon recht weitgehend dem Gegengeschlecht angleichen, und sei es mit Prothesen oder chirurgischen Maßnahmen.
Was vielen Menschen nicht bekannt ist: auch unsere Sinneswahrnehmungen sind geschlechtsspezifisch. So haben Frauen einen erheblich feineren Tastsinn als Männer und sehen bei Dunkelheit und am Rand des Sehfeldes besser, während Männer im Blickzentrum und vor allem bei bewegten Objekten genauer sehen und bestimmte Geräusche feiner unterscheiden können. Durch Training lassen sich solche Fähigkeiten allerdings in recht weiten Grenzen variieren.
Was ich im Schema »seelische Fähigkeiten« genannt habe, umfasst unsere angeborene Fähigkeit zu Gefühlen. Hier gibt es, wie auch schon bei den Wahrnehmungsfähigkeiten, weite Überschneidungen zwischen dem männlichen und dem weiblichen Bereich, aber dennoch auch Unterschiede. So ist bekanntlich der Pflegeinstinkt gegenüber Kindern oder Jungtieren bei Frauen stärker ausgeprägt, während Männern eine deutlich höhere Aggressionsbereitschaft zugeschrieben wird. Das heißt keineswegs, dass der eine das andere nicht könnte; es heißt nur, dass er eine geringere Neigung hat, es zu tun – wie wir es ja im täglichen Leben überall auf der Welt beobachten können.
Mit den geistigen Fähigkeiten und der sozialen Einordnung als Mann oder Frau kommen wir endgültig in Bereiche, die gemeinhin als prinzipiell geschlechtsunabhängige Kulturprodukte gelten. Aber die Unterscheidung in angeborene und erworbene Fähigkeiten ist im Grunde künstlich und hat mit der Realität nicht viel zu tun. In Wahrheit hängt das eine mit dem anderen untrennbar zusammen. So wird sich z. B. eine Frau immer etwas anders kleiden als ein Mann – und zwar nicht nur, weil man ihr das von Kind auf so beigebracht hat, sondern unter anderem auch deshalb, weil sich ein und derselbe Stoff für eine weibliche Haut mit ihrem feineren Tastsinn anders anfühlt als für eine männliche. Umgekehrt haben sogar vererbte körperliche Geschlechtsunterschiede teilweise ihre Ursachen in erlerntem Verhalten früherer Generationen: wenn z. B. bestimmte weibliche Körpermerkmale kulturell bedingt als besonders sexy gelten, werden Frauen mit diesem Merkmal mehr Geschlechtsverkehr haben und folglich ihre Veranlagung an mehr Kinder weitergeben als andere Frauen.
Lassen wir also den Streit, ob vererbt oder erlernt, beiseite, und ebenso den Streit um die Ursachen der Abweichungen von geschlechtlichen Normen. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich die Meinung Dörners in Berlin vertrete, die Ursache von Transsexualität sei eine gehirnphysiologische Besonderheit aufgrund einer veränderten hormonellen Situation während der Schwangerschaft. Was man mit einer solchen Erkenntnis dann anfängt, ist eine andere Frage; das muss sicher noch ausgiebig diskutiert werden.
Aber auch die Fraktion der Psychoanalytiker geht ja in ihrer großen Mehrheit von der Erfahrungstatsache aus, dass das transsexuelle Anders-Sein so tief im Menschen verankert ist, dass wir nicht anders können als damit leben zu lernen. Beseitigen lässt sich diese Veranlagung nach allem, was wir wissen, jedenfalls bei einem erwachsenen Menschen nicht – insofern ist das für die Betroffenen ein akademischer Streit ohne praktische Auswirkungen.
Widmen wir uns also einfach dem, was ist. Zwei für unser Thema wichtige Aspekte unserer Geschlechtlichkeit bleiben noch zu erwähnen: unser sexuelles Selbstbild, das unter anderem Auswirkungen auf die Art hat, wie wir uns unseren Geschlechtspartnern nähern und in welcher Art, mit welchen sexuellen Praktiken wir den Geschlechtsakt am meisten genießen können – und schließlich die sexuelle Orientierung: die Frage also, ob wir als Partner Männer oder Frauen bevorzugen.
Jeder einzelne dieser Punkte bietet uns – ganz individuell und bei jedem Menschen wieder anders – einen spezifischen geschlechtlichen Spielraum. Und jeder der hier genannten Punkte ist wiederum eine Zusammenfassung von vielen Eigenschaften, in denen unsere geschlechtliche Position wiederum ganz unterschiedlich aussehen kann. Wenn Sie mir soweit gefolgt sind, dann wird wohl meine Auffassung verständlicher, dass es den transsexuellen oder den homosexuellen Menschen oder den Transvestiten eigentlich gar nicht gibt. Denn selbst der globale Begriff von »Mann« oder »Frau« ist schon eine grobe Vereinfachung: in Wahrheit gibt es so viele unterschiedliche geschlechtliche Ausprägungen, wie es Menschen gibt.
Das soll uns nicht daran hindern, gewisse typische »Pakete« von Eigenschaften herauszuarbeiten, in denen wir uns selbst und andere Menschen – bei aller gebotenen Vorsicht – wiedererkennen können. Wenn wir die typischen Lebensspielräume bestimmter Gruppen von Menschen in unser Schema eintragen, dann ergibt sich eine Art Diagramm,
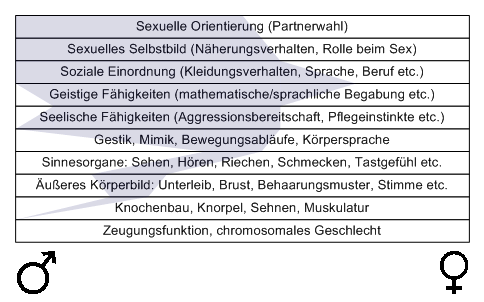
das die Gesamtheit der spezifisch geschlechtlichen Lebensmöglichkeiten dieser Menschen darstellt. Für einen durchschnittlichen Mann könnte ein solches Diagramm etwa so aussehen: Im unteren, körperlichen Bereich ist er in engen Grenzen auf seine Männlichkeit festgelegt. Je mehr die Aspekte mit erlernten kulturellen Eigenschaften zu tun haben, desto breiter wird der Bewegungsspielraum: bei den geistig-rationalen Leistungen schließlich steht beiden Geschlechtern jeweils fast das ganze geschlechtliche Spektrum zur Verfügung – aber auch hier eben nur fast. Ein Rest überlegener sprachlicher Begabung der Frau bleibt übrig – wohlgemerkt: hier ist von durchschnittlichen Männern und Frauen die Rede – und beim Mann ein überlegenes räumlich/bildliches Vorstellungsvermögen. Männer und Frauen haben unterschiedlich strukturierte Gehirne.
Setzen wir nun ein durchschnittliches weibliches Diagramm dagegen.

Legen Sie mich da bitte nicht auf einzelne Werte und Grenzen fest: darüber lässt sich trefflich streiten. Den Diagrammen liegt keine quantitative Erhebung zugrunde; sie dienen nur dazu, bestimmte Grundprinzipien zu verdeutlichen.
Legen wir die beiden Diagramme so übereinander
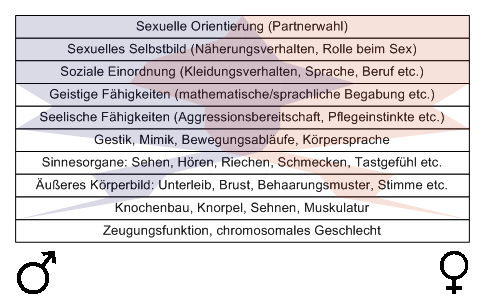
dann sehen wir dass sich der männliche und weibliche Bereich im gesamten Teil der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und Handelns überschneiden. Ich will es durch eine Schraffierung noch zusätzlich verdeutlichen:
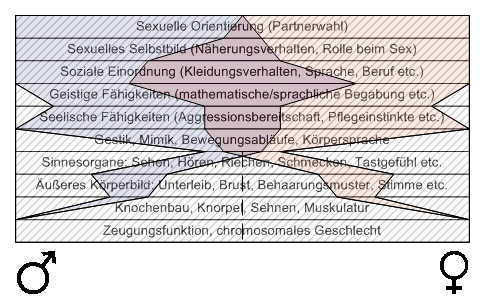
Es gibt da einen geschlechtlich indifferenten Bereich, der beiden Geschlechtern gleichermaßen offen steht – und andererseits geschlechtsspezifische Bereiche – hier schraffiert –, die jeweils nur einem Geschlecht zugehören. Die Gründe dafür sind einfach in der Macht der Masse zu suchen: das, was die große Mehrheit tut oder empfindet, wird zur sozialen Norm. Und so wird von jedem Mann das erwartet, was der durchschnittliche Mann tut: sich nämlich im spezifisch männlichen und im indifferenten Teil der Lebensspielräume zu bewegen und sich aus den spezifisch weiblichen Teilen herauszuhalten – die sind für ihn genauso Tabuzone wie für eine Frau die spezifisch männlichen Bereiche. Wer solche Tabus bricht, verunsichert die Mehrheit der Menschen in ihren naiven Anschauungen über die Geschlechter – seine geschlechtlich-sozialen Signale werden als widersprüchlich empfunden – und folglich erntet er Ablehnung und Anfeindungen (2).
Nun wissen wir alle, dass es Menschen gibt, die sich einfach nicht in ein solches Lebensschema hineinpressen lassen. Der häufigste Fall sind Homosexuelle:
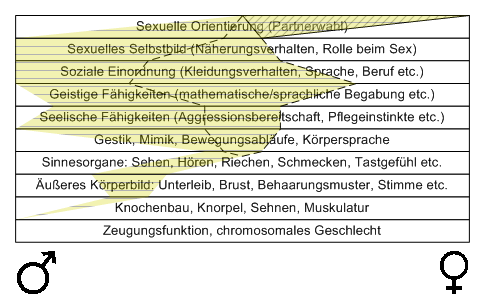
ganz normale Männer bis auf den einen Unterschied, dass die sexuelle Orientierung bei ihnen umgedreht ist. In diesem einen Punkt – aber wirklich nur in diesem einen! – könnte man sie als »weiblich« bezeichnen, denn »normalerweise« ist es eine Eigenschaft von Frauen, als Sexualpartner Männer zu bevorzugen. In allen anderen Punkten, inklusive ihres Selbstbildes und der Art ihrer Sexualpraktiken, sind Homosexuelle Männer ohne Wenn und Aber. Deshalb haben sie auch heute – nach Beendigung der Strafverfolgung ihrer Sexualität – nur noch wenig Probleme mit der Gesellschaft. Ihre Sexualität leben sie ohnehin unter ihresgleichen aus, und ansonsten fallen sie kaum aus dem gesellschaftlichen Rahmen.
Etwas komplizierter wird es für eine Minderheit unter den Homosexuellen: die weiblich geprägten.
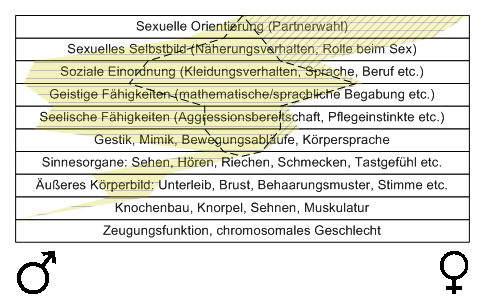
Bei diesen Menschen sitzt das Anders-Sein tiefer: nicht nur die Partner-Orientierung ist umgedreht, sondern auch teilweise das sexuelle Selbstbild – eine mehr passive, hingebende Art beim geschlechtlichen Akt, nicht ganz so wie bei einer Frau, aber doch schon in diese Richtung verschoben. Auch bei Mimik und Gestik, beim Kleidungsverhalten und anderen Dingen neigen solche Männer bereits zu einer gewissen Verschiebung in den weiblichen Bereich: dieser angeblich typische »Schwule« prägt das Bild der Homosexuellen in der Öffentlichkeit, obwohl er gegenüber den männlich orientierten Homosexuellen klar in der Minderzahl ist. Er fällt einfach mehr auf, weil er bereits hier und da öffentlich in gegengeschlechtliche Tabuzonen vorstößt.
Hier nun ein Diagramm eines »typischen« Mann-zu-Frau-transsexuellen Menschen
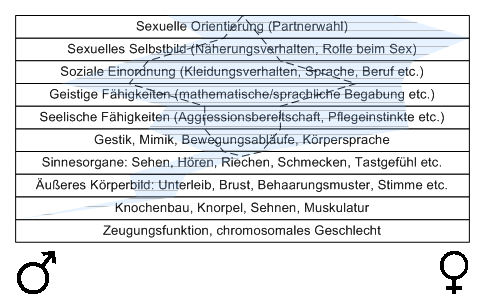
Man möge mir verzeihen, dass ich den Gedankengang ganz von der biologisch männlichen Seite her entwickle: in umgekehrter Richtung – Frau-zu-Mann also – sind die Verhältnisse ähnlich, mit gewissen Unterschieden, deren genauere Darstellung hier zu weit führen würde.
Bei einem transsexuellen Menschen liegt der Schwerpunkt des Anders-Seins – im Gegensatz zu Homosexuellen – nicht mehr im Bereich der unmittelbar sexuellen Aktivitäten. Im Gegenteil: oft liegt die Partnerorientierung sogar in einem Bereich, der zu einem durchschnittlichen Mann passen könnte. Die Mehrzahl der Transsexuellen ist von der Partner-Orientierung her bisexuell veranlagt.
Dagegen beobachten wir bei Transsexuellen verstärkt das, was sich schon beim weiblich orientierten »Schwulen« angedeutet hat: eine in diesem Fall extreme Verschiebung des sexuellen Selbstbildes nach der weiblichen Seite; auch der gesamte sonstige Bereich des Denkens, Fühlens, und Verhaltens ist erheblich nach der weiblichen Seite hin verschoben. Und sogar der Körperbau weist oft schon von Natur aus – freilich noch innerhalb der Bandbreite männlicher Eindeutigkeit eine leichte Verschiebung zur weiblichen Seite hin auf: Mann-zu-Frau-Transsexuelle haben nicht selten einen relativ zarten Knochenbau mit für einen Mann vergleichsweise breitem Becken, kleinem Schädel und gewissen vermutlich angeborenen weiblichen Bewegungsabläufen, z. B. beim Werfen von Gegenständen.
Umgekehrt haben wir MzF-Transsexuelle ein Defizit bei spezifisch männlichem Verhalten. Zwar steht uns durchaus ein Teil des Repertoires zur Verfügung, das gemeinhin als männlich gilt. Wenn aber von uns erwartet wird, das gesamte Arsenal männlicher Verhaltensweisen auszuschöpfen – insbesondere gegenüber »normalen« Frauen, die ihre Vorstellung von »normalen« Männern auf uns projizieren – dann geraten wir schnell in Überforderung und Stress. Es entspricht einfach nicht unserer Art.
Wie kann nun ein solcher Mensch leben?
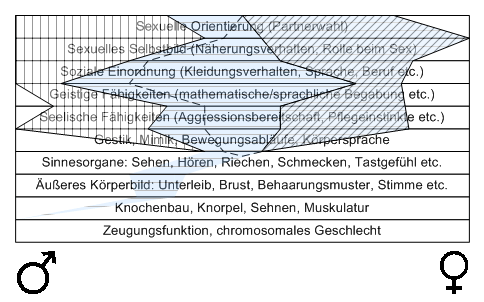
Es gehört zu unserem Schicksal, dass wir zunächst einmal versuchen müssen, in unserem körperlichen Geschlecht zu leben. Das hat immerhin einen Vorteil: unser geschlechtsspezifischer Körper darf so bleiben, wie er ist und eckt dabei nicht an. Aber im sozialen Leben und in der Partnerschaft bedeutet dieser Versuch Einschränkungen und erheblichen Stress: einerseits das gesellschaftliche Tabu, einen großen Teil dessen zu leben, was an Möglichkeiten in uns steckt – andererseits Erwartungen an unsere Männlichkeit, die wir schlechterdings nicht erfüllen können. Was bleibt, ist ein höchst eingeschränktes Leben, das uns zudem wegen der dauernden Überforderung im männlichen Bereich massive Minderwertigkeitskomplexe einträgt. Wenn man die Überforderung gegen die von Natur aus geringeren spezifisch männlichen Lebensmöglichkeiten aufrechnet, dann bleibt von dem gesamten geschlechtlichen Leben nicht mehr viel übrig: ein sozial zwangskastrierter Mensch. Vielleicht stammt daher das Vorurteil, Transsexuelle seien asexuelle Menschen: die Gesellschaft würde es am liebsten so sehen, um das Phänomen an sich einfach übersehen und an ihrem überkommenen Bild von Geschlechtlichkeit festhalten zu können.
Alles in allem eine Situation, die auf Dauer kaum zu ertragen ist. Viele von uns enden durch Selbstmord oder fliehen in Suchtverhalten, wenn sie nicht irgendwann den Absprung in die einzige Alternative wagen: in den Wechsel der Geschlechtsrolle nämlich.
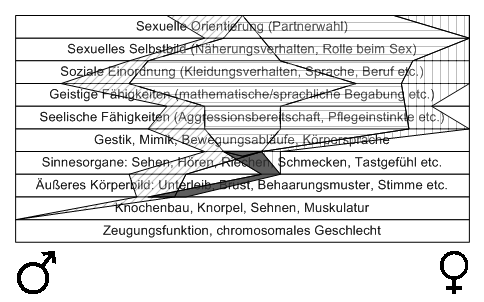
Eine Lösung, die man eigentlich nur als das kleinere übel bezeichnen kann, denn sie löst keineswegs alle Probleme und schafft zusätzlich neue. Zwar steht nun ein großer Bereich spezifisch weiblichen Lebens zur Verfügung und braucht endlich nicht mehr unterdrückt zu werden. Aber dafür wird jetzt ein – freilich kleinerer – männlicher Lebensspielraum zum Tabu, und im weiblichen Bereich entsteht eine gewisse Überforderung; denn so sehr Frau ist kaum eine MzF-Transsexuelle, dass sie so ohne weiteres und ohne Stress die komplette weibliche Rolle leben könnte. Die meisten von uns sind ja von Kind auf männlich sozialisiert, haben somit ganz andere Lernerfahrungen als biologische Frauen.
Dazu kommt der bekannte Leidensweg einer – sowieso nur unzulänglich möglichen – körperlichen Umgestaltung. Die Zeugungsfähigkeit fällt ganz weg, ansonsten muss der Körper weitgehend versteckt und maskiert werden: eine Situation, die vom humanistischen Ideal einer gesunden Seele in einem gesunden Körper meilenwert entfernt ist. Trotzdem, wie gesagt: für viele von uns ist es das kleinere übel – ja, oft die einzige Möglichkeit, überhaupt ein halbwegs erfülltes Leben zu führen.
Ein paar Worte noch zu der gelegentlich vertretenen Auffassung, Transsexualität sei eine nicht eingestandene, verdrängte Form von Homosexualität. Springer in Wien hat diese These schon Anfang der 80er Jahre vertreten, und hier und da taucht sie wieder neu auf – zuletzt bei Frau Kamermans in ihrem Buch »Mythos Geschlechtswechsel«, das im übrigen einen sehr guten Überblick über die transsexuelle Problematik vermittelt.
Sehen wir uns die Sache rein phänomenologisch als Lösungsvorschlag an,
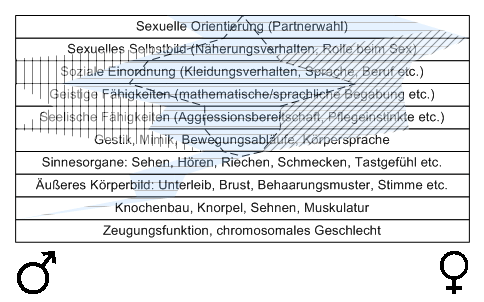
dann müssen wir erkennen, dass das Ausleben einer angeblichen Homosexualität für Transsexuelle höchstens eine Teillösung sein kann. Im gesamten sozialen Bereich bleiben genau dieselben Einschränkungen und Überforderungen bestehen, unter denen Transsexuelle in der Rolle ihres körperlichen Geschlechts nun mal leiden. Nur bei der unmittelbar sexuellen Tätigkeit tritt eine gewisse Entspannung ein – vorausgesetzt, die MzF-Transsexuelle steht auch wirklich auf Männer und kann mit der Tatsache umgehen, dass sie von dem homosexuellen Partner als Mann gesehen und geliebt wird. Es mag Fälle geben, für die das ein gangbarer Weg ist; auch zwischen effeminierten Homosexuellen einerseits und Transsexuellen andererseits gibt es ja beliebige Übergangsformen, und die von Springer beschriebenen Verdrängungsmechanismen mögen bei solchen Menschen durchaus vorkommen. Aber hüten wir uns davor, das zu verallgemeinern:
Wenn wir uns das Diagramm einer lesbischen MzF-Transsexuellen ansehen
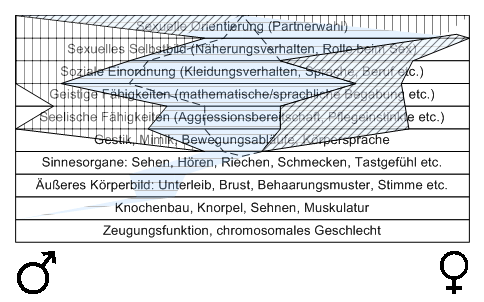
und hier den Lösungsweg anbieten, eine angeblich verdrängte Homosexualität auszuleben, dann wird die Sache vollends grotesk: hier stimmt gar nichts mehr. Ausgerechnet in dem einzigen Bereich, der für einen solchen Menschen beim Verbleib im biologischen Geschlecht wenigstens halbwegs problemlos wäre – bei der Partnerorientierung nämlich – soll er nun gegen seine Natur und gegen gesellschaftliche Konventionen invertiert leben! Ein absolutes Unding…
Hier sehen wir auch den Grund, warum so viele Transsexuelle so allergisch auf die weit verbreitete Verwechslung mit Homosexuellen reagieren. Das hat in der Regel nichts mit Verurteilung oder Abwehr von Homosexualität zu tun. Auch wir sind ja eine geschlechtliche Minderheit, auch wir haben als Besonderheit gegengeschlechtliche Anteile – wenn auch vorwiegend in anderen Bereichen und auf sehr viel breiterer Basis als Homosexuelle. Insofern sind wir den Homosexuellen verwandt und haben jegliches Verständnis für sie.
Aber uns mit ihnen zu verwechseln hieße, uns Lösungsmodelle anzudienen, die für viele von uns noch mehr Leid und Stress bedeuten würden als der bloße Verbleib in der Rolle des körperlichen Geschlechts. Vor allem bei der Partnersuche – bei Transsexuellen sowieso schon ein schwieriges Thema – erweist sich dieses hartnäckige Vorurteil oft noch als zusätzlicher Hemmschuh: Frauen, die entsprechend unserer meist passiven Art eigentlich aktiv auf uns zukommen müssten, um eine uns gemäße intime Beziehung einzuleiten, tun das oft nur deshalb nicht, weil sie unsere Passivität als homosexuelles Desinteresse an der Frau missdeuten. Und wir selbst wiederum missdeuten die Passivität der Frau dann als fehlendes Interesse an der Person. Ich möchte nicht wissen, wie viel eigentlich mögliches Liebesglück uns durch solche Missverständnisse vorenthalten bleibt – ich selber könnte aus meinem Leben einige Beispiele erzählen.
Das alles war nur Vorrede. Erschrecken Sie nicht, liebe Zuhörer: ich habe nicht vor, drei Stunden zu reden. Dass ich den größeren Teil meines Referats für diese Einführung benötigt habe, liegt daran, dass ich für mein eigentliches Thema den Rahmen schaffen musste, in dem mein Anliegen überhaupt erst verständlich wird. Mein Anliegen: das sind Menschen, die – wie ich selbst – zwar ansatzweise eine transsexuelle Veranlagung in sich tragen, die aber nur unvollständig ausgeprägt ist – psychische Zwitter sozusagen. Eine solche teilweise Transsexualität sehen Sie in diesem Diagramm
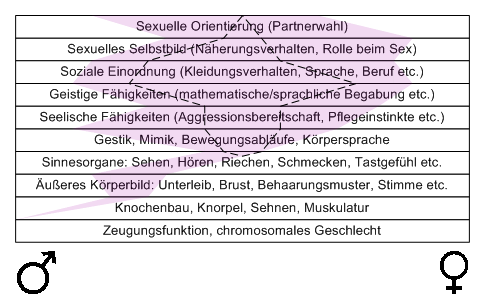
dargestellt. Der Körper ist im Wesentlichen männlich, während im Bereich der Wahrnehmung und Empfindungen, der Gefühle und des sozialen und geschlechtlichen Verhaltens männliche und weibliche Anteile sich so ziemlich die Waage halten. Das Profil entspricht in seiner Form weitgehend dem einer voll ausgeprägten Transsexualität, aber die Verschiebung geht weniger weit.
Es scheint relativ viele solche Menschen zu geben – weniger zwar als Homosexuelle, aber nach meinen Beobachtungen wohl doch mehr als »echte« Transsexuelle, für die der Geschlechtswechsel der einzig mögliche Weg ist. Letztere stellen wohl so etwas wie die Spitze des Eisbergs dar.
Was tun mit einer solchen Veranlagung? Den Mann leben?
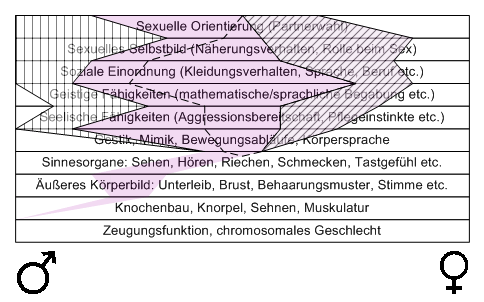
Wir stehen hier vor derselben Problematik wie bei echten Transsexuellen, die versuchen, im körperlichen Geschlecht zu bleiben – wenn auch in etwas abgemilderter Form: einerseits Verzicht auf einen Großteil des individuellen Lebenspotentials, andererseits Stress durch Überforderung. Nicht ganz so unerträglich zwar wie bei einer voll ausgeprägten Transsexualität, aber genug, um doch sehr erheblichen Leidensdruck zu erzeugen.
Die Alternative – der Geschlechtswechsel – ist auch kein gangbarer Weg.
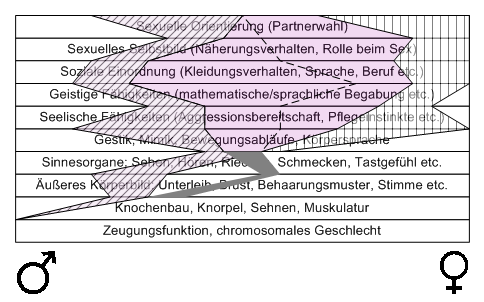
All die Schmerzen und Risiken der körperlichen Umgestaltung führen hier nur zu dem Ergebnis, dass die Probleme hinterher in ihr Gegenteil verkehrt sind: nun darf die ja doch noch recht deutlich vorhandene männliche Seite nicht mehr ausgelebt werden, und auf der weiblichen Seite sind wir erheblich überfordert. – Dasselbe in grün. Was also tun – um Gottes Willen?
Versucht man als Mensch mit dieser Veranlagung, sein Potential an Lebensmöglichkeiten auszuschöpfen – dieses Potential ist ja nicht geringer, es ist nur anders gelagert als bei sogenannten »normalen« Männern und Frauen – dann kommt man nicht umhin, gesellschaftlichen Konventionen den Kampf anzusagen.
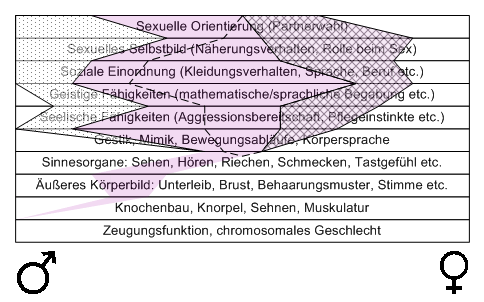
Der Verzicht auf eine der beiden geschlechtsspezifischen Seiten – gleich welche – ist keine Lösung. Der Lebensbereich, auf den verzichtet werden müsste, ist einfach zu groß, um ohne Leidensdruck und psychopathologische Folgen ein solch einseitiges Leben führen zu können; dazu kommen Erwartungsdruck und Überforderung in dem Geschlecht, zu dem man sich bekennt.
Menschen mit einer solchen Veranlagung leiden im Grunde weniger an sich selbst als an der Gesellschaft – genauer gesagt: an ihren geschlechtlichen Konventionen. So sehe ich als einzig möglichen Lösungsweg, – nein, eben nicht ein androgynes Leben im geschlechtlich indifferenten Bereich: das hieße Verzicht auf beiden Seiten, eine Entsexualisierung sozusagen. Zwar liegt in der Tat das Zentrum unserer geschlechtlichen Identität in diesem indifferenten Bereich. Aber unser Leben besteht ja nicht aus dem Einnehmen eines starren Standpunktes. Leben heißt immer variieren, einen Lebensspielraum bis an seine ganz individuellen Grenzen ausloten. Und diese Grenzen liegen bei Menschen unserer Art weit im spezifischen Bereich beider Geschlechter.
Die Lösung kann also nur sein, offen und erklärtermaßen beide Geschlechter für sich in Anspruch zu nehmen – teilweise Mann zu bleiben und als solcher gegen alle gesellschaftlichen Tabus und ausdrücklich auch körperlich und sexuell in urweibliche Teilbereiche einzudringen, soweit die Natur oder ein frühkindliches Schicksal das in uns angelegt hat. Das nicht nur, um uns bisher verschlossene Lebensbereiche zu öffnen, sondern auch, um der Umwelt klarzumachen: Ich bin kein Mann im üblichen Sinne, überfordert mich bitte nicht als solchen. Und schließlich auch als Signal an einen möglichen Geschlechtspartner: denn nicht nur der Partner (in meinem Fall die Partnerin) muss zu mir passen, auch ich muss ja zu meinem Partner passen! Wie soll ein potentieller Partner jemals die für ihn richtige Wahl treffen, wenn ich mich nicht so zeige, wie ich bin? Und wie soll ich jemals glücklich sein mit einer Partnerin, die in mir die falsche Wahl getroffen hat? Eben das war die Tragödie meiner Ehe, und es ist die Tragödie vieler, vieler Ehen von Leidensgenossen.
Eine geschlechtlich eindeutige Erscheinung – gleichgültig, ob männlich oder weiblich – bedeutet für Menschen mit unserer Veranlagung, permanent falsche Signale an unsere Umwelt zu geben – eine Lebenslüge. Wir sind weder Mann noch Frau, sondern eine Mischung aus beidem, ein drittes Geschlecht: Wir sind psychische Zwitter. Für ein in sich stimmiges Leben müssen wir das auch nach außen signalisieren.
Das offene Bekenntnis eben nicht zu Geschlechtslosigkeit, sondern zu beiden Geschlechtern gleichzeitig ist ein schwieriger Weg, begleitet von vielerlei Hindernissen und Anfeindungen. Selbst mancher von Ihnen hier im Saal wird wohl bei meinem zugegebenermaßen ungewöhnlichen Anblick im ersten Moment massive Aversion oder Verachtung empfunden haben. Das mag Ihnen verdeutlichen, wie sehr sogar wir Transsexuelle selber in eben den gesellschaftlichen Vorurteilen verfangen sind, unter denen wir selbst zu leiden haben.
Die erste große Hürde, die sich vor solchen Menschen auftut, ist denn auch die Frage der Selbsterkenntnis. Ich selbst habe über zwei Jahrzehnte des Herumstolperns und Herumstocherns, des Ausprobierens und Versagens gebraucht, bis sich die Stolpersteine endlich zu einem sinnvollen Mosaik zusammenfügten und ich lernen konnte, mit meiner Veranlagung anstatt gegen meine Veranlagung zu leben. Wir bekommen als Kinder nicht systematisch beigebracht, was ein Mann und was eine Frau ist – und schon gar nicht, dass wir selbst irgendetwas dazwischen seien. Nein: man ordnet uns mit der Geburt einfach in ein Geschlecht ein, und angesichts unserer eindeutigen Körperlichkeit haben wir zunächst auch keinerlei Chance, diese Unterstellung anzuzweifeln. Erst unsere Unfähigkeit, dieses Geschlecht dann auch konsequent zu leben, erschließt uns indirekt die Tatsache des Andersseins – nach vielen verzweifelten Versuchen, nach vielen Tränen, Enttäuschungen und Verletzungen.
Für den Erkenntnisprozess – und mehr noch für den zweiten Schritt, nämlich in unserer ganzen Zwittrigkeit ein angemessenes geschlechtliches Selbstbewusstsein aufzubauen – ist eine Psychotherapie bei einem mit der Problematik vertrauten Therapeuten fast unerlässlich. Die gesellschaftlichen Vorurteile über »Männlichkeit«, »Weiblichkeit« und geschlechtliche Moralität sitzen auch tief in uns selbst; davon Abschied zu nehmen ist mit großer Angst und Schmerzen verbunden – ganz besonders, wenn man selbst so sehr von den Dogmen angeblicher Normalität abweicht. Auch in Begleitung eines Therapeuten, der einem in kritischen Momenten stützend die Hand reicht, ist dieser Weg immer noch schwer genug. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen: denn nur er führt schließlich zu einem vollständigen, erfüllten Leben, wie es unserer Art angemessen ist.
Wenn mir jemand einen bequemeren, gesellschaftlich besser akzeptierten Weg zu einem erfüllten Leben zeigen kann, bin ich gerne bereit ihm zu folgen. Aber nach meiner Erfahrung ist es besser, all das auf sich zu nehmen, als einen Großteil dessen zu unterdrücken, was an Energie und Lebensfreude in uns zweigeschlechtlichen Wesen steckt. Unterdrücken lässt sich diese Energie auf Dauer sowieso nicht. Was da unterdrückt werden müsste, ist geschlechtliche Energie, und die ist so stark und tief in uns verwurzelt, dass sie auf längere Sicht allemal die Oberhand über unseren Willen gewinnt. Es ist meine persönliche Erfahrung und daher auch meine Überzeugung, dass die bei fast allen MzF-Transsexuellen zu beobachtenden masochistischen Neigungen nichts anderes sind als unterdrückte weibliche Sexualität: ein verklausuliertes Sich-Hingeben, Sich-Ausliefern an einen körperlich überlegenen, sexuell aktiv vordringenden Geschlechtspartner, wie es jede ganz normale Frau beim ganz normalen Verkehr mit einem Mann lustvoll erlebt. Sexuelle Phantasien von Fesselungen und dergleichen haben mich zu der Zeit am meisten – und wegen ihres Ersatzcharakters auch am quälendsten – gefangen genommen, als ich am konsequentesten versucht habe, sexuell den Mann zu mimen, der ich nun mal nicht bin.
Der dritte und entscheidende Schritt ist schließlich, unsere zweigeschlechtliche Art auch tatsächlich, praktisch und alltäglich zu leben. Das ist nicht einfach und auch leider nicht so vollständig möglich, wie es wünschenswert wäre; denn wir kollidieren dabei nicht nur mit verbreiteten Wert- und Moralvorstellungen – allein das wäre schon Hindernis genug –, sondern wir kämpfen zusätzlich mit dem Problem, etwas zu sein, was es nach gängigen Vorstellungen dieser Gesellschaft gar nicht gibt. Erinnern wir uns: nach landläufiger Meinung gibt es Männer und Frauen. Punkt. In der Vorstellungswelt der meisten Menschen ist für solche Zwischenwesen wie uns schlicht kein Platz. Konfrontieren wir sie mit unserer Art, dann versuchen sie zunächst einmal, mit Unterstellungen ihr gewohntes Menschenbild aufrecht zu erhalten.
Um das an einem Beispiel zu veranschaulichen: wenn ich schwimmen gehe, entspricht es eigentlich mehr meiner Art, einen Damenbadeanzug zu tragen als eine Badehose. Zum einen hasse ich einfach diesen Schock des kalten Wassers am Bauch, zum anderen gibt es an meiner Brust – dank Östrogentherapie – auch ohne diese Prothesen noch etwas zu verhüllen, was ich – wie jede ganz normale Frau – nicht überall frei zur Schau stellen mag.
Tue ich also das, was meinem Sein entspricht, dann wird das von beliebigen Augenzeugen ganz anders interpretiert: in deren Augen bin ich eben nicht ein Zwitterwesen, das sich entsprechend seiner Art kleidet, sondern schlicht ein Mann, der etwas tut, was sich für einen Mann nicht gehört. Es wird mir aufgrund meiner ansonsten männlichen Gestalt einfach unterstellt, auch da oben flach zu sein und die immerhin sichtbaren – wenn auch kleinen – Rundungen unter dem Badeanzug mit irgendeinem Material ausgestopft zu haben. Und nicht genug damit: als Motiv für die angebliche Maskerade wird mir typisch männlich-aggressive Triebhaftigkeit in sogenannter pervertierter Form unterstellt: Transvestismus – hier verstanden als eine Art Missbrauch der Öffentlichkeit zu sexueller Erregung, welche nach unseren gesellschaftlichen Konventionen doch eigentlich im intimsten Rahmen bleiben sollte. Die Botschaft, wie sie bei den Zuschauern ankommt, heißt also nicht, wie es richtig wäre: »Dieser Mensch ist etwas anderes als ein Mann«, sondern: »dieser Mann ist geistig und moralisch nicht in Ordnung, der ist pervers, sperrt mal bloß schnell die Kinder weg, denn bei so einem (…Mann…) muss man ja mit allem rechnen!«
So ergibt sich die paradoxe Situation, dass ich ein weibliches Accessoire weglassen muss, um ein tatsächlich vorhandenes Stück Weiblichkeit glaubhaft machen zu können. Laufe ich am Strand oben ohne herum, dann zeigt sich wiederum eine gute Seite unserer Kultur: es ist eine wohltuende Sitte in unserer westlichen Welt, jemanden in seiner Körperlichkeit – wie auch immer diese sein mag – so zu akzeptieren, wie er ist. Man mag verstohlene, irritierte Blicke ernten, vielleicht auch einmal ein Tuscheln hinter vorgehaltener Hand – aber offene Anfeindungen oder unverhohlenen Spott habe ich deshalb noch nie erlebt, nicht einmal Isolation, obwohl ich mitunter recht offen mit meinem geschlechtlich zweideutigen Körper umgehe. Im Gegenteil: mehr, als mir manchmal lieb ist, ist dieses doch so offensichtliche Thema in Gesprächen ein Tabu. Ich sehe die fragenden Blicke in den Augen meiner Mitmenschen, würde ihnen auch gerne Antwort auf ihre Fragen geben – wenn diese Fragen denn überhaupt gestellt würden. Man traut sich nicht. Und von sich aus ein solches Thema anzusprechen, hat immer ein Stück Exhibitionismus an sich, ein unangemessenes Sich-Aufdrängen.
Warum überhaupt so weit gehen und den Körper verändern – warum nicht einfach mit den Leuten reden? Warum nicht die soziale Rolle so weit ändern, dass sich ein zweigeschlechtliches Bild ergibt? Es gab und gibt ja Gesellschaften, z. B. im heutigen Jemen, in denen Menschen wie wir ohne irgendwelche Probleme einfach trotz ihres männlichen Körpers in der weiblichen Rolle leben und anerkannt werden.
Nun: zum einen haben auch solche Gesellschaften wie die im Jemen ihre Starrheiten und Vorurteile: dort z. B. die Tatsache, dass von den als Frauen lebenden Männern eine homosexuelle Veranlagung erwartet wird, womit lesbische MzF-Transsexuelle auch dort große Probleme haben dürften. Zum anderen leben wir leider nicht in einem Land, in dem solche Lebensformen anerkannt sind; derartige Institutionen müssen wir in unserer Gesellschaft erst noch schaffen.
Auch Reden allein löst das Problem nicht. Der Prozess der geschlechtlichen Erkennung und Einordnung läuft nonverbal ab und dazu schnell, möglichst unauffällig und im Ergebnis endgültig – bis ich mit einem fremden Menschen die ersten Worte wechsle, stecke ich in aller Regel schon längst in der Schublade »Mann« – samt allen Rollenerwartungen, die daran geknüpft sind. Und selbst wenn ich meiner Geliebten in stundenlangen Gesprächen erläutere, was alles an mir weiblich statt männlich sei: sobald sie einen nackten männlichen Körper ohne jede spürbare Weiblichkeit in den Armen hält, hat sie all das vergessen und konfrontiert mich wieder mit den verfluchten falschen Rollenerwartungen, weil einfach die Sprache unserer Sinne und die lebenslang eingeübten geschlechtlichen Assoziationen ungleich mächtiger sind als alle Worte.
Wir können daran arbeiten, das ein Stück weit zu ändern; aber bis solche Bemühungen – wenn überhaupt – zu einem für unser individuelles Leben tragfähigen Ergebnis führen können, vergeht mit Sicherheit mehr als die Zeit einer Generation. Es würde jetzt zu weit führen, die Mechanismen zu beschreiben, die dahinter stecken und uns Transsexuellen das Leben manchmal so schwer machen. Stefan Hirschauer hat für sein Buch »Die soziale Konstruktion der Transsexualität« unter anderem diese Materie untersucht – mit sehr aufschlussreichen Ergebnissen. Das Buch sei jedem empfohlen, der sich für das Thema näher interessiert, wenn es auch leider wegen seines schauderhaften Soziologen-Kauderwelsch schwer zu lesen ist.
Wie das vorhin genannte Beispiel mit dem Badeanzug schon zeigte, ist eine zweigeschlechtliche Identifikation durch äußere Signale – durch eine bestimmte Kleidung oder durch ein bestimmtes Sozialverhalten – in unserer Gesellschaft nicht möglich. Bis zu einem gewissen (sehr hohen!) Grad an weiblichen Signalen werde ich trotzdem als Mann angesehen; die gegenteiligen Signale werden nicht als Ausdruck eines anderen Seins interpretiert, sondern nur als angeblich ungehöriges Tun (3).
überschreite ich mit den weiblichen Symbolen eine gewisse – wie gesagt: sehr hohe – Grenze, so kippt der Effekt ins Gegenteil: dann werde ich als Frau identifiziert, und die männlichen Signale werden entweder ignoriert oder als unpassend verurteilt. Weder das eine noch das andere wird aber den Menschen gerecht, für die ich hier spreche. Um entgegen geläufigen Vorurteilen endlich so gesehen zu werden, wie wir sind, müssen wir zweigeschlechtliche Menschen die Leute buchstäblich mit nackten Tatsachen vor den Kopf stoßen: mit einem zweigeschlechtlichen Körper. Und selbst dann müssen wir den Leuten noch erklären, dass dieser Körper nicht etwa das Zufallsergebnis irgendeiner Erkrankung, sondern harmonischer Ausdruck unserer Persönlichkeit ist. Erst dann haben wir eine Chance, dass auch oberflächlichere Signale, Accessoires und Verhaltensweisen als das verstanden werden, was sie tatsächlich bedeuten; und erst dann sind wenigstens die Menschen in unserer näheren Umgebung bereit, uns den Platz im Bereich beider Geschlechter einzuräumen, den wir brauchen.
Zweifellos ist es unbefriedigend, eine medikamentöse Veränderung unseres Körpers zu brauchen, um vorwiegend sozial zu einer harmonischen Rolle zu finden. Hier liegt ein Systembruch, der unsere besondere Art zu etwas stempelt, was sie nicht ist: eine Krankheit nämlich. Wie schon erwähnt, liegt ja das Leiden von uns Teil-Transsexuellen gar nicht so sehr in uns selbst begründet wie in der Weigerung der Gesellschaft, uns mit unseren äußeren Signalen und sozialen Interaktionen so zu erkennen und zu integrieren, wie wir sind. Aber unter den gegebenen Voraussetzungen ist eine soziale Lösung des Problems ohne individuelle medizinische Hilfe nicht in Sicht. Selbst wenn es gelänge, von heute auf morgen die Anschauungen der Menschen über unsere Geschlechtlichkeit radikal zu verändern und uns einen angemessenen Platz in der Gemeinschaft zuzuweisen – es bliebe doch die Tatsache bestehen, dass jeder einzelne von uns seit früher Kindheit unter krankmachenden sozialen Bedingungen aufgewachsen und deshalb bereits mit entsprechenden Verbiegungen und Verletzungen geprägt und sozialisiert ist.
Unabhängig von hehrer Theorie gilt in der Medizin der Grundsatz, dass Recht hat, wer heilt. Für mich persönlich war die Östrogentherapie Voraussetzung, um überhaupt erst ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper zu finden – eine Vielzahl von letztlich psychosomatischen Beschwerden, unter denen ich in früheren Jahren litt, sind seit der Psycho- und Chemotherapie verschwunden. So durchgehend körperlich gesund wie in den letzten fünf Jahren war ich in den Jahrzehnten davor nie, und im Gegensatz zu früher kann ich heute mit dem Ergebnis dieser Therapie auch sozial und geschlechtlich gut leben. Wenn es auch theoretisch erstrebenswerter wäre, einen sozialen Lösungsansatz in den Vordergrund zu stellen, so ist doch die Hormontherapie auf absehbare Zeit die einzig greifbare und für viele Betroffene im Ergebnis durchaus taugliche Lösung.
Ich möchte an dieser Stelle einen Appell an meine ärztlichen Kollegen richten, die Verschreibung von gegengeschlechtlichen Hormonen für Transsexuelle – bei aller gebotenen Vorsicht – vielleicht doch etwas freizügiger zu handhaben. Vielerorts wird die Östrogentherapie – bzw. bei FzM-Transsexuellen die Therapie mit Androgenen – nur als Ergänzung des operativen Geschlechtswechsels gesehen, nicht aber als eigenständig mögliche Alternative. Ich kann mir gut vorstellen, dass schon so manche im Endergebnis fragwürdige chirurgische Umgestaltung unterblieben wäre, wenn man den Betroffenen den in mancher Hinsicht weit unproblematischeren Weg einer Hormontherapie mit begleitender Psychotherapie als Alternative nahegelegt hätte. Auch hier, so scheint mir, sitzen immer noch viel zu viele Ärzte und Psychotherapeuten dem altüberkommenen Vorurteil auf, dass ein Mensch wenigstens in seinem äußeren Erscheinungsbild entweder Mann oder Frau zu sein habe – eine geradezu lächerliche Auffassung, wenn man als Therapeut oder Betroffener weiß, dass sich die geschlechtliche Zerrissenheit eines Transsexuellen selbst mit aller chirurgischen Kunst nicht beseitigen, sondern nur in einen etwas weniger offensichtlichen Bereich verschieben lässt. Ich selbst habe in meiner Psychotherapie mein ganz spezifisches zweigeschlechtliches Selbstbewusstsein nicht mit Hilfe, sondern eher gegen den Widerstand meiner ansonsten sehr verdienstvollen Therapeutin aufbauen müssen. Solche mühsame Pionierarbeit sollte für die Betroffenen doch irgendwann nicht immer wieder von neuem nötig sein.
Der vorhin beschriebene Prozess, sich als geschlechtliches Zwischenwesen zu erkennen zu geben, ist nicht immer und überall möglich. Es bedarf eines erheblichen Maßes an Provokation, bevor Leute bereit sind, das zu sehen, was ist – und nicht nur das, was sie sehen wollen. Wenn ich z. B. so, wie ich jetzt vor Ihnen stehe, über die Frankfurter Zeil flanieren würde: obwohl das vor allem wegen der Farbe des Pullis schon recht auffällig ist, möchte ich wetten, dass die Mehrzahl der Leute, die mir begegneten, überhaupt nichts Besonderes an mir bemerken würden (ich weiß, wovon ich rede: ich habs ausprobiert…!). Der Grund dafür ist ein selektiver Blick: wir sehen vorwiegend das, was wir zu sehen erwarten. Um etwas zu sehen, was wir an der Stelle nicht erwarten – und wer erwartet schon weibliche Brüste an einem Mann? – muss es uns schon sehr deutlich ins Auge springen. Dezente Andeutungen – wie sie dem heiklen, mit gesellschaftlichen Tabus belegten Thema eigentlich angemessen wären bleiben in so einer öffentlich-anonymen Situation wirkungslos; sie werden schlicht übersehen. Und mit einer schreiend auffälligen Präsentation skandalöses Aufsehen zu erregen, ist auch nicht jedermanns Sache.
So bleibt unsere Möglichkeit, unser Sein anderen Leuten verständlich zu machen, zwangsläufig auf einen relativ kleinen, vertrauten Kreis von Menschen beschränkt. Diese Menschen kennen uns genauer, sie sehen uns in gesellschaftlich akzeptierten Zusammenhängen auch einmal nackt, sie erleben ständig unsere mal männlichen, mal weiblichen sozialen Interaktionen, sie empfangen von uns nicht nur einzelne, sondern eine Vielzahl an geschlechtlichen Signalen in beiden Richtungen – und es sind klärende Gespräche möglich, um Missverständnisse auszuräumen. In einem solchen intimeren Umfeld können wir die Atmosphäre schaffen, die wir für unser Leben im Bereich beider Geschlechter brauchen. Auch hier geht es selbstverständlich nicht ohne Provokationen und Konflikte ab – aber welcher Bereich eines ganz normalen Lebens ist schon konfliktfrei?
Am problemlosesten ist für uns erstaunlicherweise der Bereich der intimen Partnerschaft – wenn wir uns erst einmal entschlossen haben, konsequent zu unserer Veranlagung zu stehen. Gerade vor diesem Punkt hatte ich persönlich am meisten Angst; nur die Resignation nach über 20 leidvollen Jahren, nur die Erwartung, so oder so keine Aussicht auf eine harmonische Geschlechtspartnerschaft zu haben, ließ mich schließlich über meinen Schatten springen und vorsichtig, Stück für Stück die Umgestaltung durch Östrogene wagen. Umso mehr verblüffte mich dann die Tatsache, dass sich meine jahrzehntelangen Probleme mit Partnersuche und einem harmonischen intimen Zusammensein im Lauf der Therapie buchstäblich in Luft auflösten. Was ich – der ich weiß Gott nicht auf den Mund gefallen bin – mit tausenden und abertausenden Worten den von mir begehrten Frauen nie verständlich machen konnte, das sagt heute einfach mein Körper; und es wird verstanden.
Ein Problem bleiben die Vorurteile der Gesellschaft gegen uns: die moralische Verurteilung als angebliche Perversion, die soziale Verachtung speziell der MzF-Transsexuellen als »Tunten«, die üblichen Assoziationen mit Subkultur, Rotlichtszene und Pornographie. Es ist den Leuten nicht zu verdenken, dass all diese Vorurteile weiterhin existieren, solange honorable Leute – und es gibt eine Menge solche mit unserer Problematik – sich nicht offen dazu bekennen. Solange die Öffentlichkeit nur in zwielichtigen Nachtlokalen und in Skandalberichten des Sex-and-Crime-Journalismus mit unserer besonderen Art konfrontiert wird, brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, dass die Leute eben diese Zusammenhänge mit Menschen wie uns assoziieren.
Vor vielen Jahren gab es einmal in der Schweiz eine wissenschaftliche Untersuchung, die angeblich belegte, Transsexuelle gehörten fast durchweg der untersten sozialen Schicht an, seien geistig deutlich minderbegabt und würden überdurchschnittlich oft straffällig. Wie wir heute wissen, war der einzige Grund für diese katastrophale Fehleinschätzung, dass zu der damaligen Zeit alle etwas intelligenteren, angepassteren Transsexuellen, die etwas zu verlieren hatten, sich peinlichst davor hüteten, als solche erkannt zu werden – nicht zuletzt, um nicht in den Sog einer gesellschaftlichen Pauschalabwertung zu geraten, die sich so immer wieder selbst Nahrung gab.
Diese Zeiten sind inzwischen, Gott sei Dank, vorbei; aber von dem uns zustehenden spezifischen Platz in der Gesellschaft sind wir gemischt-geschlechtliche Menschen doch noch weit entfernt. Während unsere extremer veranlagten Leidensgenossen nach erfolgtem Rollenwechsel sich doch vergleichsweise unauffällig wieder in das gewohnte Geschlechterschema einfügen können, müssen wir unseren ganz spezifischen Lebensraum als eine Gruppe mit besonderen Eigenschaften und Talenten und mit den dazu passenden sozialen Rechten und Verpflichtungen von dieser Gesellschaft erst einmal einfordern, wenn wir nicht unser Leben lang auf ein Nischendasein beschränkt bleiben wollen. Bis uns das auf breiterer Basis gelingt, werden wir noch sehr oft und sehr vielen Menschen so provokante Fragen stellen müssen wie die, mit der ich meinen Vortrag schließe: Milliarden Menschen auf dieser Welt – Männer wie Frauen – sind sich darüber einig, dass eine weibliche Brust etwas Schönes ist. Warum, zum Teufel, sollen weibliche Brüste an einem ansonsten männlichen Körper nicht auch schön sein?
Anmerkungen
(1) Normal männliche Kleidung und Erscheinung, aber ein leuchtend rosaroter Pullover, unter dem sich unübersehbar weibliche Brüste hervorheben. (Zurück zum Text)
(2) In diesem Punkt unterscheidet sich die Situation von Mann-zu-Frau-Transsexuellen grundlegend von der Situation in umgekehrter Richtung. Die spezifisch weiblichen Bereiche sind erheblich größer und zahlreicher und zudem für Männer weitaus strikter tabu als die spezifisch männlichen Bereiche für Frauen. Mann-zu-Frau-Transsexuelle leiden deshalb weit mehr unter Aussperrung, Anfeindungen und moralischer Verurteilung. Umgekehrt haben Frau-zu-Mann-Transsexuelle am Beginn ihres Weges größere Schwierigkeiten, ihr Anderssein überhaupt sichtbar werden zu lassen: im Vergleich zu der ungeheuren Vielzahl äußerlicher Weiblichkeitssymbole gibt es nur sehr wenige unmissverständliche Zeichen von Männlichkeit wie z. B. den Bart. Weiblichkeit wird vorwiegend durch die optische Erscheinung demonstriert, Männlichkeit dagegen mehr durch spezifisches Verhalten und durch die Vermeidung einer weiblichen Optik. (Zurück zum Text)
(3) Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Mann-zu-Frau-Transsexuelle den »Alltagstest« als Spießrutenlauf erleben: solange die öffentliche Identifikation als Frau nicht gelingt – angesichts der körperlichen Voraussetzungen ist dazu ja oft ungeheurer Aufwand nötig – so lange probiert man eben nicht das Leben einer Frau, sondern das eines als pervers geltenden Mannes. (Zurück zum Text)
Literaturempfehlungen
Hirschauer, Stefan: Die soziale Konstruktion der Transsexualität.
Ein Buch über die sozialen Interaktionen transsexueller Menschen – macht viele gesellschaftliche Mechanismen deutlich, unter denen Transsexuelle leiden bzw. mit denen sie ihrem Leid begegnen. Hochinteressant, nur leider in einem für Nicht-Soziologen teilweise sehr schwer verständlichen »Fachchinesisch« geschrieben.
Kamermans, Johanna: Mythos Geschlechtswechsel.
Das Buch klebt sehr an der Hypothese, Transsexualität sei eine verdrängte Form von Homosexualität. Davon abgesehen, gibt es einen guten überblick über das Phänomen Transsexualität, vor allem auch über biologische Grundlagen sowie kulturelle und geschichtliche Hintergründe.
Kamprad, Barbara / Schiffels, Waltraud (Hrsg.): Im falschen Körper.
Materialsammlung verschiedener Autoren zum Thema Transsexualität; beleuchtet das Phänomen von allen Seiten, vor allem auch medizinische und psychologische Aspekte. Gut lesbar
Moir, Anne / Jessel, David: Brainsex.
Sehr gute Darstellung dessen, was ganz normales Mann- oder Frau-Sein über die körperlichen Unterschiede hinaus bedeutet – vermittelt das nötige Grundwissen über die Geschlechter. In unterhaltsamem Stil geschrieben, gut lesbar.
Schiffels, Waltraud: Frau werden.
Schonungslos offener Lebensbericht einer Mann-zu-Frau-Transsexuellen; spannend und auch sprachlich-ästhetisch schön zu lesen. Enthält viele Details, die als typisch für die Betroffenen gelten können.
Diesen Vortrag hat Walter Greiner ursprünglich auf der Transidentitas-Fachtagung 1993 gehalten. Zunächst veröffentlicht im GenderWunderLand in leicht überarbeiteter schriftlicher Form mit seiner freundlichen Genehmigung.
Den Text habe ich mit freundlicher Genehmigung von Clara aus deren Genderwunderland übernommen